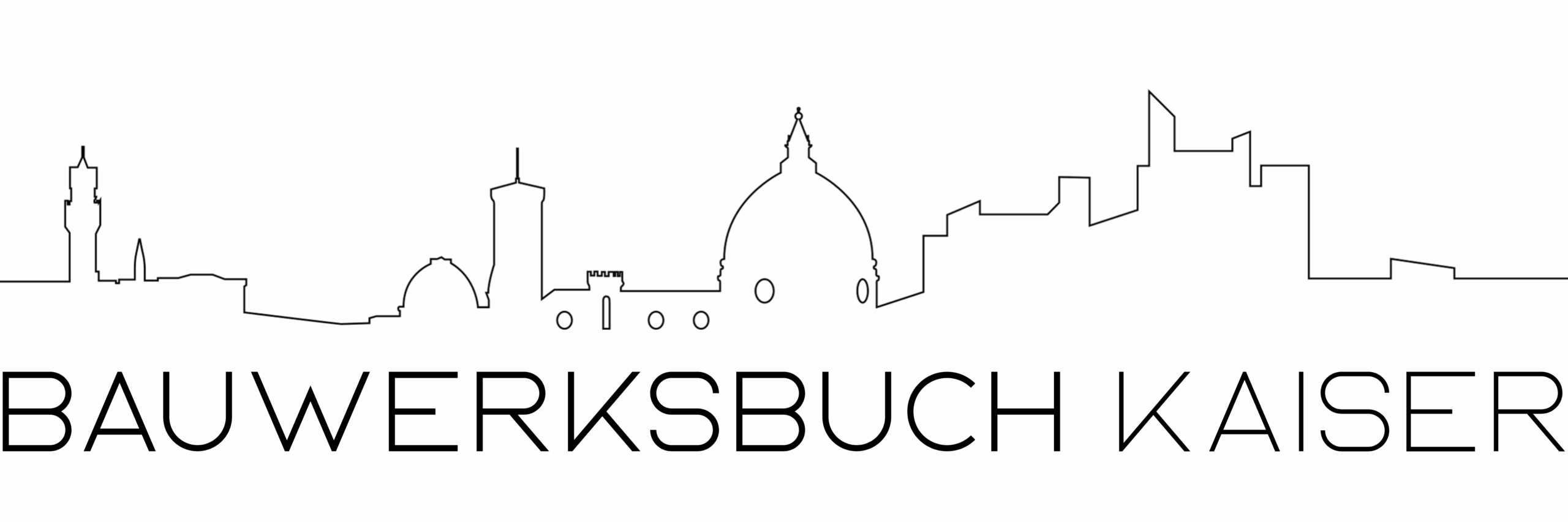Interview mit DI Johann Kaiser, MA, MBA, MSc
Sachverständiger für Bauwerksbücher und Objektsicherheit in Wien
Wie schätzen Sie den generellen Umsetzungsstand beim Thema Bauwerksbuch in Wien ein? Haben Eigentümer und Hausverwaltungen das Thema bereits am Radar?
Ja, ein Großteil der Hausverwaltungen und Eigentümer hat das Thema mittlerweile am Radar. Unsere breit angelegte Umfrage hat jedoch gezeigt, dass sich viele noch in der Evaluierungsphase befinden und nur wenige bereits aktiv in der Umsetzung sind. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Thema wird ernst genommen, aber klassisch „aufgeschoben“.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie aus der Praxis – eher Interesse und Bereitschaft oder noch viel Zurückhaltung und Unwissenheit?
Wir sind in unserem Büro bereits voll in der Umsetzung. Von Kolleginnen, Kollegen und auch größeren Anbietern höre ich allerdings, dass sich das Thema vielerorts zieht und bisher nicht so richtig „eingeschlagen“ hat. Das deckt sich mit unseren breit angesetzten Umfrageergebnissen – Interesse ist da, aber der praktische Schritt zur Umsetzung wird oft noch hinausgezögert.
Wie aufwendig ist die Erstellung eines Bauwerksbuches tatsächlich – was sind die größten zeitlichen und technischen Hürden?
Um den Aufwand korrekt zu beurteilen, muss man zunächst den angestrebten Qualitätsstandard des Bauwerksbuches definieren. Der Gesetzestext lässt sich sehr reduziert interpretieren – das würde eine schnelle, oberflächliche Erstellung ermöglichen.
Betrachtet man aber die „Erläuterungen zum Bauwerksbuch gemäß Bauordnung für Wien“, wird rasch klar, dass es deutlich komplexer ist.
Hintergrund ist, dass die Novelle letztlich eine Verlagerung der behördlichen Bauwerksüberprüfung auf Sachverständige darstellt – ähnlich wie bei der Ablöse der Kollaudierung durch die Fertigstellungsanzeige.
Der Gedanke einer Verwaltungseinsparung liegt also auf der Hand. Diese Diskussion um Aufwand oder Kosten ist aus meiner Sicht jedoch grundlegend falsch. Das Bauwerksbuch ist ein Zertifikat, von dem letztlich alle profitieren – Hausverwalter, Eigentümer und nicht zuletzt das Gebäude selbst und das Bauwerksbuch sollte daher nicht als eine Pflicht gesehen werden, sondern als ein digitales Liegenschaftsinstrument, um Schäden frühzeitig zu erkennen, dadurch unnötige Kosten zu vermeiden und den Immobilienwert nachweislich zu sichern.
Ich kann zahlreiche Beispiele nennen, bei denen frühzeitig erkannte Mängel sehr kostenintensive Folgeschäden verhindern konnten: von undichten Dächern über schadhafte Tramdecken bis hin zu kompletten Bodensanierungen infolge von vermeidbaren Wasserschäden.
Ein Beispiel bei dem man zu lange zugewartet hat: bei einer Fassadensanierung hat der Frost in kurzer Zeit zu einer massiven Verschlechterung geführt, wodurch ein Schadensgrad von 80 % abgerechnet mit über 300.000 € wurde. Wäre der Schaden frühzeitiger behoben worden, hätte derselbe Sanierungsabschnitt wie im Angebot kalkuliert bei 20 % Schadensgrad nur rund 175.000 € gekostet. Die erhöhten Kosten haben dann natürlich eine erhebliche Rücklagendiskussion bei den Eigentümern mit verbundenen Haftungsfragen für den Verwalter und dem damaligen Sachverständigen ausgelöst.
Darüber hinaus steigert ein gut geführtes Bauwerksbuch den Wert der Immobilie. Gemeinsam mit dem Energieausweis wird es künftig ähnlich wie internationale Zertifikate (DGNB, LEED, BREEAM) als Standardwerk für Liegenschaftstransaktionen dienen und Banken und Käufer werden eine Mindestqualität an das Bauwerksbuch erwarten.
Daher geht es nicht um die Frage, „Was kostet das Bauwerksbuch?“, sondern um die Qualität des Zertifikats und „Wie viel kann ich mir durch das Bauwerksbuch ersparen?“
Zur konkreten Fragebeantwortung:
Für ein durchschnittliches Wiener Zinshaus mit rund 1.250 m² Nutzfläche beträgt unser Aufwand unter Einsatz von digitalen Tools und KI rund 25 Stunden:
• 7,5 h Planeinsicht und Aktenzuordnung
• 5 h Befundaufnahme vor Ort
• 11,5 h Erstellung mit Bilddokumentation (ca. 60-80 Seiten)
• 1 h Administration und Organisation
Nicht eingerechnet sind zusätzliche Anfragen, Abstimmungen oder Risikoaufwände für Haftungsfragen. Je nach Tätigkeit und dafür vorgesehene Personen z.B.: Bauakt ausheben, Befund und Gutachten etc. liegen die Stundensätze zwischen 85 € und 150 €, was zu einem realistischen Preis von rund 2.900 € exkl. USt. für ein durchschnittliches Zinshaus von 1250 m² führt.
Der Aufwand hängt aus meinen Erfahrungswerten auch weniger von der Größe des Gebäudes ab, als von der Komplexität der Mängel und des Bauaktes – er bleibt aber dennoch relativ stabil und gut planbar und die Schwankungsbreite des Aufwandes ist überschaubar.
Viele Eigentümer sehen die Kosten kritisch. Wie erklären Sie den Nutzen eines Bauwerksbuches – auch im Hinblick auf den Werterhalt einer Immobilie?
Wie gesagt: Der Fokus sollte nicht auf den Kosten liegen, sondern auf dem Nutzen. Das Bauwerksbuch ist eine Investition in die Werterhaltung und in die Vermeidung von Folgekosten. Es schafft Transparenz, Planbarkeit und reduziert Haftungsrisiken.
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Eigentümer, Hausverwaltung und beauftragtem Fachunternehmen effizient gestaltet werden?
Das funktioniert nur, wenn das Bauwerksbuch digital angelegt ist. Die Mängelbehebung, die Abwicklung von Versicherungsschäden und die laufende Fortschreibung müssen über ein CRM-System teil- oder vollautomatisiert erfolgen. Damit wird auch das Fristenmanagement für wiederkehrende Prüfpflichten effizient eingebunden.
Wo entstehen Ihrer Erfahrung nach die meisten Verzögerungen – bei der Datenerhebung, den Unterlagen oder der Abstimmung mit Behörden?
Ganz klar bei der Planeinsicht. Die Termine sind knapp, und die Bearbeitung dauert. Deshalb sollte mit der Beauftragung frühzeitig begonnen werden.
Der Bedarf ist enorm – rund 63.000 Gebäude müssen bis 2030 erfasst werden. Wie realistisch ist es, dass diese Frist eingehalten wird?
Auch hier liegt der Engpass ausschließlich in der Planeinsicht. Wenn dieser Prozess beschleunigt oder digitalisiert wird, ist die Frist durchaus realistisch.
63.000 Gebäude / 4 Jahre sind 15.750 Gebäude pro Jahr / 250 Werktage folgen => 63 pro Tag
im Schnitt benötigt man 2 Tage für ein Gebäude, daraus folgt: es müssen 126 Personen an der Erstellung arbeiten, wobei davon die Hälfte, also 63 Sachverständige sein müssen. Diese Anzahl haben wir, je länger man aber zuwartet, desto enger wird der Flaschenhals und es ist auch davon auszugehen, dass die Preise entsprechend steigen werden.
Reichen die verfügbaren Kapazitäten der Sachverständigen, Ziviltechniker und Dienstleister aus, um den erwarteten Ansturm zu bewältigen?
Ja, das sehe ich derzeit als ausreichend an, siehe dazu die vorherige angestellte Berechnung. Der Markt hat sich aus meiner Sicht auch bereits darauf eingestellt.
Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, damit die Umsetzung beschleunigt werden kann – etwa durch digitale Tools oder eine vereinfachte Dokumentation?
Man muss zuerst klären, was genau unter „Umsetzung“ verstanden wird. Die reine Erstellung eines Bauwerksbuches ist in weniger als 25 Stunden auch mit digitalen Tools oder KI derzeit nicht realistisch. Der eigentliche Hebel liegt vielmehr in den nachgelagerten Prozessen – also in der strukturierten Weiterführung, Verwaltung und Nutzung der Daten. Dort entstehen die größten Zeit- und Kostenvorteile.
Welche Chancen bietet das Bauwerksbuch über die gesetzliche Pflicht hinaus – etwa für Instandhaltung, Nachhaltigkeit oder Versicherungsfragen?
Genau dort liegt das größte Potenzial. Wenn das Bauwerksbuch digital aufgebaut ist, kann es als zentrale Informationsquelle dienen – für Mängelmanagement, Wartungszyklen, Versicherungsschäden oder energetische Optimierungen.
Wer das nicht zu Ende denkt, zahlt später doppelt: Wenn am Ende hundert PDF-Bauwerksbücher vorliegen, muss jemand mühsam alle Fristen, Mängel und Daten manuell heraussuchen. Nicht zu vergessen, das Risiko liegt dann beim Verwalter, wenn Fristen übersehen oder notwendige Maßnahmen versäumt werden.

„Das Bauwerksbuch ist kein Verwaltungsaufwand, sondern ein Werkzeug.
Wer es richtig nutzt, spart Zeit, Geld, steigert den Immobilienwert und reduziert Haftungsrisiken. Es ist die Grundlage für den nachhaltigen Gebäudebetrieb der digitalisierten Zukunft.“